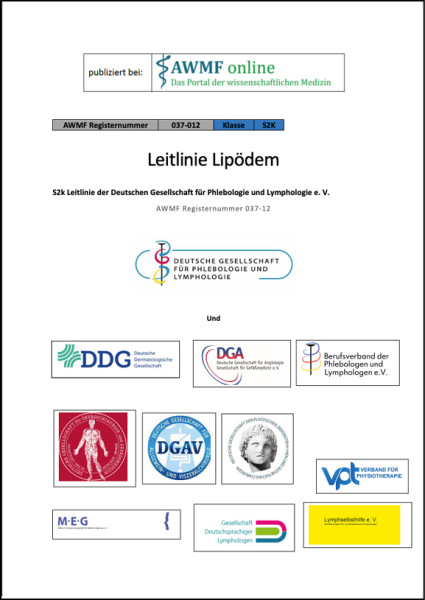von Martin Motzkus
Bisher gab es die Leitlinie zum Lipödem in der S1-Form, die jedoch einer Verlängerung bedurfte. Um die Diagnostik und Therapie des Lipödems zu optimieren, wurde sich für eine Aufwertung der Leitlinie in eine S2k-Leitlinie entschieden.
Fragt man Patienten, was sie an ihren chronischen Wunden am meisten stört, erhält man häufig ähnliche Antworten: Schmerzen, nässende Wunden, Wundgeruch und Einschränkungen durch die Wunde oder die Therapie selbst werden an erster Stelle genannt. Unsere Aufgabe als Pflegende ist es daher, wie im Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ (DNQP) beschrieben, negative Auswirkungen der Wunde oder auch der Therapie zu vermeiden. Auch Schwellungen der Beine/Extremitäten werden von den Betroffenen als sehr belastend empfunden. Daher ist die Kompressionstherapie und deren korrekte Durchführung für die Betroffenen von großer Bedeutung.
Im Gegensatz zu Menschen mit venös oder lymphatisch bedingten Ödemen fällt eine Patientengruppe häufig durch das übliche diagnostische Raster. Die Rede ist von Patientinnen und Patienten mit einem Lipödem.
Das Lipödem
Bei einem Lipödem handelt es sich um eine „schmerzhafte, disproportionale symmetrische Fettgewebsverteilungsstörung, die fast ausschließlich bei Frauen vorkommt.“ Dabei sammeln sich Fettzellen im Bereich der Extremitäten an. Füße, Hände Kopf, Hals und Körperstamm sind nicht betroffen. Im Gegensatz zur Adipositas, zu anderen Fettverteilungsstörungen und auch zum Lymphödem sind diese Schwellungen immer schmerzhaft. Die Schmerzen treten häufig bei Druck, oft aber auch bei Berührung und auch spontan auf. Die Symptomatik wird regelmäßig von einem Schweregefühl in den betroffenen Extremitäten begleitet.
Die Betroffenen leiden nicht selten unter einer Stigmatisierung und das Krankheitsbild wird häufig mit Adipositas verwechselt. Die am BMI gemessene Fettverteilungsstörung führt jedoch häufig zu einer diagnostizierten Adipositas. Dies liegt vor allem daran, dass die Vermehrung des Fettgewebes im Bereich der Extremitäten zu falsch hohen Werten führt. Die Erkrankung führt häufig zu Einschränkungen der körperlichen Aktivität und damit des Alltags, des Berufs- und Privatlebens und wird daher häufig von psychischen Problemen begleitet.
Die Ursachen des Ödems sind bis heute nicht vollständig geklärt. Da fast ausschließlich Frauen betroffen sind, werden eine X-chromosomale Störung und weibliche Hormonstörungen als auslösende Faktoren diskutiert.
Die Leitlinie zum Lipödem
Die aktualisierte Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie definiert das Krankheitsbild, erläutert Ursachen und Veränderungen durch das Lipödem und spricht Empfehlungen für Diagnostik und Therapie aus. Sie soll somit allen beteiligten Berufsgruppen eine Unterstützung und Empfehlungssammlung für die Behandlung der Betroffenen sein. Dabei entspricht diese Leitlinie in weiten Teilen einer Konsensusempfehlung von Fachexperten.
Eine einheitliche Schweregradeinteilung oder Klassifikation des Lipödems gibt es nicht, vielmehr werden die betroffenen Areale und die Ausprägung des Ödems beschrieben. Die Diagnose wird klinisch gestellt, die Ultraschalluntersuchung wird unterstützend eingesetzt, vor allem auch zum Ausschluss von Differentialdiagnosen.
Therapeutisch steht die Kompressionstherapie im Vordergrund. Ihre Durchführung ist technisch aufwendig, da den veränderten Proportionen und den zum Teil großen Extremitätenumfängen Rechnung getragen werden muss. Die Kompression reduziert natürlich nicht das Fettgewebe selbst, sondern die Auswirkungen, d.h. Schmerzen und Schwellungen.
Zur Reduktion des Fettgewebes selbst hat sich die Liposuktion, also das operative Absaugen von Fettgewebe, bewährt. Diese muss oft mehrmals durchgeführt werden. Bisher wird der Eingriff jedoch nur in seltenen Fällen auf Antrag von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Derzeit läuft eine Studie, die der Gemeinsame Bundesausschuss 2023 in Auftrag gegeben hat.
Anhand der Daten sollen Kosten, Nutzen und Risiken einer solchen Operation abgeschätzt werden. Das Zentrum für Klinische Studien (ZKS) der Universität zu Köln wird gemeinsam mit der Hautklinik des Klinikums Darmstadt die geplante Studie wissenschaftlich begleiten und die Ergebnisse auswerten. Bis 2025 soll dann eine Entscheidung über die Frage der Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen vorliegen.
Hilfe für Betroffene
Hilfe finden Betroffene in spezialisierten Zentren, aber auch bei gemeinnützigen Vereinen. In Deutschland ist hier seit vielen Jahren vor allem die Lipödem Hilfe Deutschland e.V. aktiv, deren Vorsitzende, Marion Tehler, aktuell Betroffene zum 20. Dieser findet am 04.05.24 in Hannover statt. Für Kurzentschlossene sind noch einige Plätze frei.